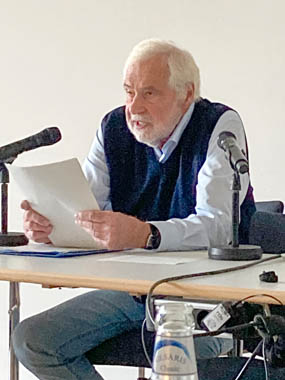Zurück
Zwischen Mythos und Moderne
Der Westpreußen-Kongress 2024 befasste sich mit politischen Dynamiken und kulturellen Herausforderungen der selbstständigen Provinz Westpreußen von 1878 bis 1920
Westpreußens kurzes Silbernes Zeitalter – Aufbruch der preußischen Provinz in der Kaiserzeit lautete der Titel des Westpreußen-Kongresses 2024, der vom 27. bis 29. September in Warendorf tagte. Die gezielt eingeleitete Restitution einer eigenständigen Provinz im Jahr 1878 kann als Beginn des »Silbernen Zeitalters« Westpreußens bezeichnet werden, das sich bewusst auf das »Goldene Zeitalter« der Herrschaft des Deutschen Ordens bezog. Diese historische Bezugnahme zeitigte jedoch eine ambivalente politische Dynamik: Während Westpreußen nach der Reichsgründung von 1871 eine beeindruckende ökonomische Entwicklung erlebte, war diese historische Phase zugleich von einem wachsenden Nationalismus auf deutscher – und in Reaktion hierauf auch von polnischer – Seite geprägt. Die Politik Preußens und die Haltung der deutschen Mehrheitsbevölkerung, die das »Deutschtum« stark betonten, führten zu einer zunehmenden Ausgrenzung der polnischen und kaschubischen Volksgruppe. Solche nationalistischen Tendenzen begünstigten die Politisierung der Gesellschaft und schufen Spannungen, die die Stabilität der Region untergruben. Der scheinbare Fortschritt des »Silbernen Zeitalters« war somit begleitet von gesellschaftlichen Konflikten, die in der historischen Zäsur von 1919/1920 – der Auflösung der Provinz nach dem Ersten Weltkrieg – mündeten. So erwies sich dieses Zeitalter letztlich als ein »Tanz auf einem Vulkan«. Unter diesem aussagekräftigen Titel steht wiederum die gegenwärtige Sonderausstellung des Westpreußischen Landesmuseums. Im Zeichen einer im vergangenen Jahr erneut aufgenommenen Zusammenarbeit zwischen der Westpreußischen Gesellschaft und dem Westpreußischen Landesmuseum lud dieses die Tagungsteilnehmer zur intensiven Auseinandersetzung mit der Ausstellung ein.
Zunächst aber eröffnete Dr. Christian Pletzing (Flensburg) am Abend des 27. September den Kongress mit einem Vortrag unter dem Titel Aufbruch und Emanzipation? Von der »Provinz Preußen« zur Wiederbegründung der Provinz Westpreußen 1878. Dabei zeichnete der Historiker die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen nach, die sieben Jahre nach Gründung des Deutschen Reichs zur Wiederherstellung der Provinz Westpreußen führten. Vorausgegangen war – im Anschluss an die Reorganisation Preußens nach dem Wiener Kongress von 1815 – die Vereinigung von Ost- und Westpreußen zur »Provinz Preußen« im Jahr 1829 unter Oberpräsident Theodor von Schön. Dessen Ziel war es, ein neues preußisches Landesbewusstsein zu schaffen, das auf der Tradition des Deutschen Ordens basierte. Im 19. Jahrhundert erlebte die Provinz dynamische Entwicklungen: Hatte Königsberg im Vormärz als liberales politisches Zentrum gegolten, entwickelte sich nun Danzig ab den 1860er Jahren zur wirtschaftlich und politisch führenden Stadt, unterstützt durch den florierenden Handel über den Danziger Hafen und verschiedene städtische Modernisierungsprojekte. Die wachsenden wirtschaftlichen und administrativen Unterschiede zwischen Ost- und Westpreußen führten ab 1872 zu verstärkten Forderungen nach einer Teilung der Provinz, insbesondere da Westpreußen sich in der gemeinsamen Verwaltung benachteiligt fühlte. Trotz intensiver Lobbyarbeit und hitziger Debatten in Landtag und Abgeordnetenhaus wurde die Trennung zunächst abgelehnt. 1877 setzte sich die »Danziger Agitation« jedoch durch, und das Staatsministerium stimmte der Teilung zu. Am 1. April 1878 wurde die Provinz Westpreußen offiziell wiederhergestellt – ein Erfolg, der als Aufbruch hin zu einer neuen regionalen Identität gefeiert wurde.
PD Dr. Lutz Oberdörfer (Greifswald) referierte am Morgen des 28. September über Die wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Westpreußen im Deutschen Kaiserreich. Sein Beitrag beleuchtete den schwierigen Weg vom agrarischen Hinterland zu einer modernen Provinz. Während sich einzelne Regionen in eine Industriegesellschaft wandeln konnten, waren in anderen Teilen Westpreußens zunächst noch die Abwanderung von Arbeitskräften sowie die Randlage innerhalb des Kaiserreichs als nachhaltig hemmende Faktoren eines sozioökonomischen Aufschwungs spürbar. Oberdörfer hob hervor, dass dann vor allem der Ausbau der Infrastruktur – insbesondere des Eisenbahnnetzes – ab etwa 1900 einen Wendepunkt markierte: »Westpreußen war kein Stillstandsgebiet, sondern eine Region des verzögerten Fortschritts.« Dennoch blieb die wirtschaftliche Dynamik ungleich verteilt: Während Städte wie Danzig durch Großbetriebe und die Hafenentwicklung florierten, stagnierten ländliche Gebiete trotz Fortschritten in der Landwirtschaft. Der Vortrag schloss mit einer Analyse der politischen und wirtschaftlichen Fördermaßnahmen, die die Grundlage für eine regional diversifizierte Wirtschaft legten: Wenn sie auch erst in den letzten Friedensjahren des Kaiserreichs spürbare Wirkung zeitigten, trugen sie doch zu einer gesellschaftlichen Modernisierung sowie einer merklichen Hebung des Lebensstandards bei.
Im Zentrum des Vortrags Die Rückbesinnung auf Westpreußens »Goldenes Zeitalter«: Das Projekt des Deutschen Ordens und seine Vollendung in der Hohenzollern-Herrschaft von Martin Koschny M. A. (Warendorf) stand die vielschichtige historische Rolle des Deutschen Ordens und dessen spätere ideologische Aufladung durch die Hohenzollern-Dynastie. Der Referent zeichnete eindrucksvoll den Weg des Ordens von seinen Ursprüngen als Spitalbruderschaft im Heiligen Land bis zur Etablierung eines mächtigen Ordensstaates im Ostseeraum nach. Dabei akzentuierte er, in welcher Weise die militärischen, administrativen und missionarischen Aktivitäten den Ordensstaat prägten und damit zur späteren Stilisierung dieser Epoche als »Goldenes Zeitalter« Westpreußens beitrugen. Sodann zeichnete der Vortrag jedoch auch die langsam voranschreitende Schwächung des Ordens durch externe Konflikte, insbesondere mit Polen-Litauen, sowie die interne Säkularisierung im Jahr 1525 nach. In einem zweiten Schritt arbeitete Koschny die Instrumentalisierung des historischen Erbes des Deutschen Ordens durch die Hohenzollern ab dem 19. Jahrhundert heraus. Besonders die Restaurierung der Marienburg sowie die pompöse Feier zur Eröffnung von Hochschloss und Schlosskirche 1902 unter Kaiser Wilhelm II. verdeutlichten, wie die mittelalterliche Symbolik des Ordens für die preußisch-deutsche Nationalitätenpolitik nutzbar gemacht wurde. Der Kaiser selbst entwarf das Narrativ einer historischen Kontinuität bis in die eigene politische Gegenwart und erklärte in seiner Rede: »Jetzt ist es wieder so weit. Polnischer Übermut will dem Deutschtum zu nahe treten, und ich bin gezwungen, mein Volk aufzurufen zur Wahrung seiner nationalen Güter.« Der Vortrag eröffnete einen kritischen Blick auf die ideologischen Verzerrungen, die sich aus der Glorifizierung des Deutschen Ordens zum Nationalmythos im Deutschen Reich ergaben, und bot damit ein eindrucksvolles Beispiel für die Wirkungsmacht dieser Geschichtskonstruktion.
Martin Koschny, der seit diesem Jahr das Westpreußische Landesmuseum leitet, blieb dem Auditorium nach seinem Vortrag als Gesprächspartner erhalten. In einem gemeinsamen Workshop mit dem Tagungsleiter und Vorsitzenden der Westpreußischen Gesellschaft, Prof. Dr. Erik Fischer, erarbeitete er zusammen mit dem Publikum (und moderiert durch den Berichterstatter) Grundlinien einer musealen Darstellung des Problemkreises, mit dem sich der Kongress befasste. Diese Diskussion erschloss auf diese Weise zugleich zentrale konzeptionelle Ansätze der gegenwärtigen Sonderausstellung des Landesmuseums.
Im Anschluss an diese museologischen Erkundungen hatten die Teilnehmer des Kongresses Gelegenheit, die Ausstellung selbst in den Blick zu nehmen. Im klug durchdachten Arrangement der vielfältigen Dokumente werden die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen der wiederentstandenen Provinz ebenso dargestellt wie ihre inneren Konflikte und Widersprüche. Ein Zeitstrahl veranschaulicht die Verflechtung unterschiedlicher Ereignisse, während zwölf Emblemata als symbolische Sinnbilder die prägenden Kräfte dieser Epoche erschließen. Raumkörper und Biographien prominenter Persönlichkeiten geben Einblicke in die facettenreichen gesellschaftlichen Zusammenhänge dieser Zeit und vermitteln einen plastischen Eindruck von den Spannungen zwischen deutschen und polnischen Kulturträgern.
Zurückgekehrt ins Tagungshaus, beleuchtete Prof. Dr. Jens Boysen (Warschau) in seinem Vortrag Nationale Spaltung statt regionaler Integration: Die Polenpolitik im Deutschen Reich und ihre Konsequenzen für die Provinz Westpreußen die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen dem deutschen Staat und der polnischen Volksgruppe in den Ostprovinzen des Kaiserreichs und stellte dabei Westpreußen in den Fokus. Der Vortrag begann mit einer Analyse der demografischen und wirtschaftlichen Struktur Westpreußens, das im Vergleich zur Provinz Posen eine stärkere deutsche Prägung aufwies, weshalb sich hier auch die deutsche Polenpolitik weniger drastisch auswirkte. Detailliert beleuchtete Boysen die »Ostflucht« und die Ansiedlungspolitik des Deutschen Reiches. Er zeigte, dass Maßnahmen wie das Ansiedlungsgesetz von 1886, das den Zuzug deutscher Bauern fördern sollte, nur begrenzte Erfolge erzielten. Stattdessen stieg die wirtschaftliche und organisatorische Stärke der polnischen Bevölkerung durch die Entstehung genossenschaftlicher Strukturen und Banken. Besondere Aufmerksamkeit widmete der Referent dem Kulturkampf, der nicht nur die polnische, sondern auch die katholische deutsche Bevölkerung betraf. Diese Auseinandersetzungen führten zu einer Solidarisierung mit der Kirche und einer stärkeren Orientierung der Polen an ihrer eigenen nationalen Identität. Boysen betonte: »Die Polenpolitik des Kaiserreichs hat vor allem eines bewirkt: Sie stärkte das Bewusstsein für die Eigenständigkeit der polnischen Nation.« Abschließend reflektierte der Referent die langfristigen Folgen der Polenpolitik, insbesondere die Zerstörung gewachsener Strukturen nach dem Ersten Weltkrieg, die darauf zielte, die Ansiedlungspolitik rückgängig zu machen, und in den folgenden Jahren viele Deutsche verdrängte. Der Vortrag verdeutlichte, wie die politischen Maßnahmen nicht nur das Zusammenleben ethnischer Gruppen beeinträchtigten, sondern auch ungewollt zur polnischen Nationsbildung beitrugen.
Beschlossen wurde der Samstag durch die (in der vorhergehenden Ausgabe dokumentierte) Verleihung der Westpreußen-Medaille 2024 an Piotr Olecki, den Gründer und Leiter des »Militärhistorischen Museums« in Thorn.
Joanna Stanclik M. A. (Thorn) nahm am Morgen des 29. September die Zuhörer in ihrem Vortrag Bekenntnisse zum Reich und zu Deutschland: Imperiale Stadtarchitektur und die Besetzung des öffentlichen Raums in Westpreußen mit auf einen Spaziergang durch die Architekturgeschichte Thorns und Danzigs. Dabei beleuchtete sie die Entwicklung öffentlicher Bauten und deren symbolische Aufladung im Kontext der deutschen und polnischen Geschichte. In Danzig bildeten das Altstädtische Rathaus und der Artushof zentrale Wahrzeichen, die sowohl in der Blütezeit der Hanse als auch später die Identität der Stadt prägten. Mit der Urbanisierung im 19. Jahrhundert entstanden neue repräsentative Bauten wie das Oberpräsidialgebäude oder das Polizeidienstgebäude im Stil der Renaissance. Der Abbruch der Festungswälle ermöglichte die Errichtung von Verwaltungsgebäuden wie der Reichsbank und dem Hauptbahnhof, die optisch durch eine Mischung aus Backstein und Sandstein auffielen. Thorn wurde durch seinen Festungscharakter geprägt, der erst Ende des 19. Jahrhunderts durch die Stadterweiterung und die Planung neuer Wohn- und Militärviertel wie der Wilhelmstadt aufgelockert wurde. Auch hier dominierte der Neurenaissancestil, sichtbar an Bauten wie dem Königlichen Amtsgericht und der Reformierten Kirche. Prägend war die Errichtung von Kasernen und Mietshäusern, die den militärischen und zivilen Alltag vereinten. Die Referentin veranschaulichte die Verbindung von Architektur und Macht, indem sie auf Denkmäler und Gebäude hinwies, die die preußisch-deutsche Herrschaft symbolisierten, darunter das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Insgesamt verdeutlichte der Vortrag, wie Architektur als Ausdrucksmittel nationaler Identität und politischer Ambitionen eingesetzt wurde.
Prof. Dr. Bettina Schlüter (Bonn) wiederum führte die Zuhörer in ihrem Vortrag Farben – Töne – Wörter – Bilder in, wie der Untertitel lautete, Die Landessymbole der autonomen preußischen Provinz Westpreußen ein. Im Mittelpunkt standen das Westpreußenlied und das Provinzialwappen, deren Entstehung und Wirkung sie detailliert analysierte. Zu Beginn beleuchtete sie die »performative Kraft« von Symbolen, die abstrakte Ideen in greifbare Formen übersetzen und kollektive Identität stiften. Sie zeigte, wie das Westpreußenlied durch seine eingängige Melodie und den patriotischen Text die Verbundenheit zur Region stärkte. Diese Hymne, 1901 gedichtet, entwickelte sich besonders während der Abstimmungskämpfe von 1920 zur kollektiven Ausdrucksform einer Gemeinschaft, die sich als bedroht empfand. Schlüter betonte die emotionale Kraft des gemeinsamen Singens, das nicht nur Erinnerungen wachhielt, sondern auch politisch mobilisierte. Das Provinzialwappen stellte die Referentin als ein politisch umkämpftes Symbol vor. Es repräsentiere Westpreußens komplexe Geschichte, in der sich Loyalitäten zwischen Deutschem Orden, Polen und Preußen durchkreuzten. Die Einführung des Wappens 1881 mit dem schwarzen Adler und dem schwertbewehrten Arm spiegele nationale und regionale Identitätskonflikte wider, die bis heute Nachhall finden. Abschließend reflektierte Schlüter den Bedeutungswandel solcher Symbole. Diese sind mittlerweile Teil einer Erinnerungskultur geworden, die die nationale Vergangenheit kritisch einzuordnen und den europäischen Raum als gemeinsames Kulturerbe zu akzentuieren vermag. Ihr Vortrag verband historische Analyse mit der Reflexion aktueller erinnerungspolitischer Tendenzen und sensibilisierte für die vielschichtige Bedeutung historischer Symbole.
In der Abschlussdiskussion traten die vielfältigen Aspekte der in den drei Tagen diskutierten Zugänge noch einmal deutlich hervor. Dabei zeigte sich hier erneut, dass die Weise, in der heute Westpreußens »Silbernes Zeitalter« erinnert werden kann, nicht eindimensional zu verstehen ist und vielfältige Wahrnehmungen das Bild von diesem historischen Zeitraum prägen. In seinen Schlussworten dankte der Tagungsleiter allen Referentinnen sowie Referenten und darüber hinaus dem Bundesministerium des Innern und für Heimat, das den Kongress durch seine großzügige finanzielle Förderung ermöglicht hatte.
■ Tilman Asmus Fischer